Der Tatort „Verblendung“ vom 19.01.25 hat mit über 1700 Programmbeschwerden einen Nerv getroffen. Im Film wurden in die fiktive Story verpackt so ziemlich jedes rechte Framing bedient und auch auf konservative Narrative geschossen. In der Summe wurde ein „vergiftetes“ Stück als Unterhaltung verkauft, um das gängige Narrativ des ÖRR zu präsentieren.
Jetzt liegt eine recht ausführliche Antwort auf die Beschwerde vor. Auf drei Seiten wird dem Beschwerdeführer klar gemacht, dass er Unrecht hat. Ein Tatort ist schließlich eine erfundene Geschichte und alle enthaltenen Narrative werden selbstverständlich „richtig“ eingeordnet.
Der klare Blick auf den Medienskandal wird also wiederum als „Schwurbelei“ geframed. Wir sind einfach nicht klug genug, die dargebotene „Unterhaltung“ auch richtig einzuordnen.
Was haltet ihr von der Antwort unten?
Wir empfehlen auf jeden Fall, wenn ihr zu den Beschwerdeführern gehört, eine Eskalation der Beschwerde (geht einfach über die App).
Beste Grüße,
Euer Rundfunk-Alarm-Team
–
Hier haben wir das Antwortschreiben der ARD vollständig zum Nachlesen:
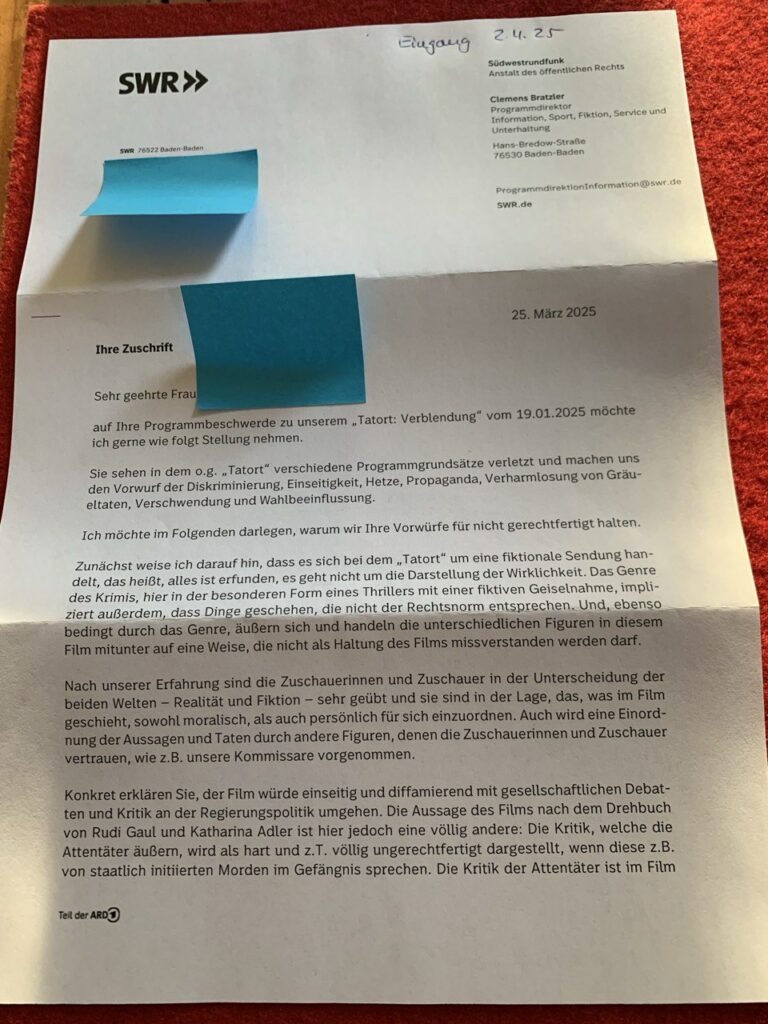
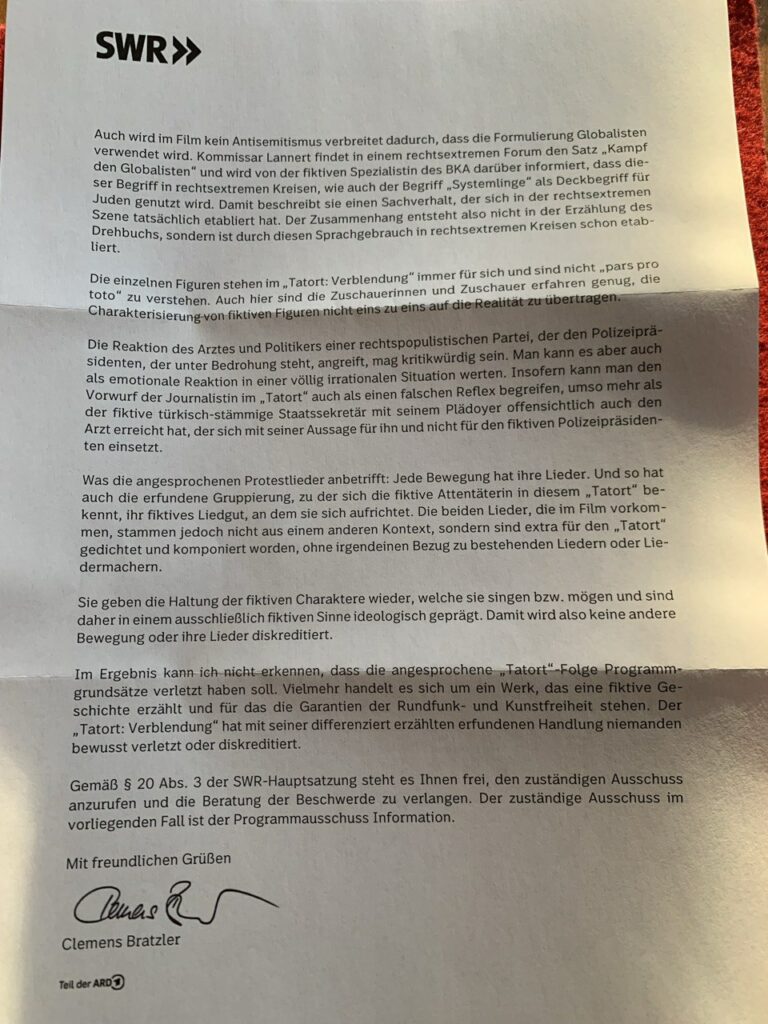
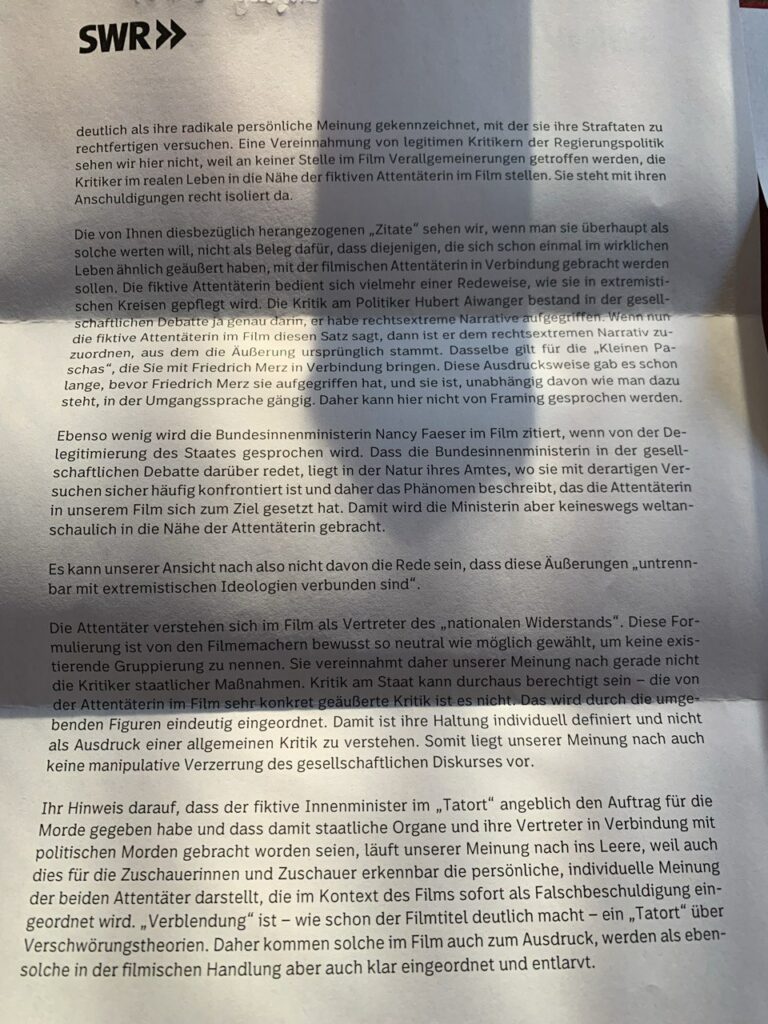
–
Sehr geehrte Frau
auf Ihre Programmbeschwerde zu unserem „Tatort: Verblendung“ vom 19.01.2025 möchte ich gerne wie folgt Stellung nehmen.
Sie sehen in dem o.g. „Tatort“ verschiedene Programmgrundsätze verletzt und machen uns den Vorwurf der Diskriminierung, Einseitigkeit, Hetze, Propaganda, Verharmlosung von Gräueltaten, Verschwendung und Wahlbeeinflussung.
Ich möchte im Folgenden darlegen, warum wir Ihre Vorwürfe für nicht gerechtfertigt halten.
Zunächst weise ich darauf hin, dass es sich bei dem „Tatort“ um eine fiktionale Sendung handelt, das heißt, alles ist erfunden, es geht nicht um die Darstellung der Wirklichkeit. Das Genre des Krimis, hier in der besonderen Form eines Thrillers mit einer fiktiven Geiselnahme, impliziert außerdem, dass Dinge geschehen, die nicht der Rechtsnorm entsprechen. Und, ebenso bedingt durch das Genre, äußern sich und handeln die unterschiedlichen Figuren in diesem Film mitunter auf eine Weise, die nicht als Haltung des Films missverstanden werden darf.
Nach unserer Erfahrung sind die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Unterscheidung der beiden Welten – Realität und Fiktion – sehr geübt und sehen in der Lage, das, was im Film geschieht, sowohl moralisch, als auch persönlich für sich einzuordnen. Auch wird eine Einordnung der Aussagen und Taten durch andere Figuren, denen die Zuschauerinnen und Zuschauer vertrauen, wie z.B. unsere Kommissare vorgenommen.
Konkret erklären Sie, der Film würde einseitig und diffamiere mit gesellschaftlichen Debatten und Kritik an der Regierungspolitik umgehen. Die Aussage des Films nach dem Drehbuch von Rudi Gaul und Katharina Adler ist hier jedoch eine völlig andere: Die Kritik, welche die Attentäter äußern, wird als hart und z.T. völlig ungeeignet dargestellt, wenn diese z.B. von staatlich initiierten Morden im Gefängnis sprechen. Die Kritik der Attentäter ist im Film deutlich als ihre radikale persönliche Meinung gekennzeichnet, mit der sie ihre Straftaten zu rechtfertigen versuchen. Eine Vereinnahmung von legitimen Kritiken der Regierungspolitik sehen wir hier nicht, weil an keiner Stelle im Film Verallgemeinerungen getroffen werden, die Kritik im realen Leben in die Nähe der fiktiven Attentäterin im Film stellen. Sie steht mit ihren Anschuldigungen recht isoliert da.
Die von Ihnen diesbezüglich herangezogenen „Zitate“ sehen wir, wenn man sie überhaupt als solche werten will, nicht als Beleg dafür, dass diejenigen, die sich schon einmal im wirklichen Leben ähnlich geäußert haben, mit der filmischen Attentäterin in Verbindung gebracht werden sollen. Die fiktive Attentäterin bedient sich vielmehr einer Redeweise, wie sie in extremistischen Kreisen gelegentlich wird. Die Kritik am Politiker Hubert Aiwanger bestand in der gesellschaftlichen Debatte ja genau darin, er habe rechtsextreme Narrative aufgegriffen. Wenn nun die fiktive Attentäterin im Film diesen Satz sagt, dann ist er dem rechtsextremen Narrativ zugeordnet, aus dem die Äußerung ursprünglich stammt. Dasselbe gilt für die „Kleinen Pauschas“, die Sie mit Friedrich Merz in Verbindung bringen. Diese Ausdrucksweise gab es schon lange, bevor Friedrich Merz sie aufgegriffen hat, und sie ist, unabhängig davon wie man dazu steht, in der Umgangssprache gängig. Daher kann hier nicht von Framing gesprochen werden.
Ebenso wenig wird die Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Film zitiert, wenn von der De-legitimierung des Staates gesprochen wird. Die Bundesinnenministerin in der gesellschaftlichen Debatte darüber, liegt in der Natur ihres Amtes, wo sie mit derartigen Versuchen sicher häufig konfrontiert ist und daher das Phänomen beschreibt, das die Attentäterin in unserem Film sich zum Ziel gesetzt hat. Damit wird die Ministerin aber keineswegs weltanschaulich in die Nähe der Attentäterin gebracht.
Es kann unserer Ansicht nach also nicht davon die Rede sein, dass diese Äußerungen „untrennbar mit extremistischen Ideologien verbunden sind“.
Die Attentäter verstehen sich im Film als Vertreter des „nationalen Widerstands“. Diese Formulierung ist von den Filmemachern bewusst so neutral wie möglich gewählt, um keine existierende Gruppierung zu nennen. Sie vereinnahmt daher unserer Meinung nach gerade nicht die Kritiker staatlicher Maßnahmen. Kritik am Staat kann durchaus berechtigt sein – die von der Attentäterin im Film sehr konkret geäußerte Kritik ist es nicht. Das wird durch die umgebenden Figuren eindeutig eingeordnet. Damit ist ihre Haltung individuell definiert und nicht als Ausdruck einer allgemeinen Kritik zu verstehen. Somit liegt unserer Meinung nach auch keine manipulative Verzerrung des gesellschaftlichen Diskurses vor.
Ihr Hinweis darauf, dass der fiktive Innenminister im „Tatort“ angeblich den Auftrag für die Morde gegeben habe und dass damit staatliche Organe und ihre Vertreter in Verbindung mit politischen Morden gebracht worden seien, läuft unserer Meinung nach ins Leere, weil auch dies für die Zuschauerinnen und Zuschauer erkennbar die persönliche, individuelle Meinung der beiden Attentäter darstellt, die im Kontext des Films sofort als Falschbeschuldigung eingeordnet wird. „Verblendung“ ist – wie schon der Filmtitel deutlich macht – ein „Tatort“ über Verschwörungstheorien. Daher kommen solche im Film auch zum Ausdruck, werden als ebensolche in der filmischen Handlung aber auch klar eingeordnet und entlarvt.
Auch wird im Film kein Antisemitismus verbreitet dadurch, dass die Formulierung „Globalisten“ verwendet wird. Kommissar Lannert findet in einem rechtsextremen Forum den Satz „Kampf den Globalisten“ und wird von der fiktiven Spezialistin des BKA darüber informiert, dass dieser Begriff in rechtsextremen Kreisen, wie auch der Begriff „Systemlinge“ als Deckbegriff für Juden genutzt wird. Damit beschreibt sie einen Sachverhalt, der sich in der rechtsextremen Szene tatsächlich etabliert hat. Der Zusammenhang entsteht also nicht in der Erzählung des Drehbuchs, sondern ist durch diesen Sprachgebrauch in rechtsextremen Kreisen schon etabliert.
Die einzelnen Figuren stehen im „Tatort: Verblendung“ immer für sich und sind nicht „pars pro toto“ zu verstehen. Auch hier sind die Zuschauerinnen und Zuschauer übertragenen Charakterisierung von fiktiven Figuren nicht eins zu eins mit der Realität zu übertragen.
Die Reaktion des Arztes und Politikers einer rechtspopulistischen Partei, der den Polizeipräsidenten, der unter Bedrohung steht, angreift, mag kritikwürdig sein. Man kann es aber auch als emotionale Reaktion in einer völlig irrationalen Situation werten. Insofern kann man den Vorwurf der Journalistin im „Tatort“ auch als einen falschen Reflex begreifen, umso mehr als der fiktive türkisch-stämmige Staatssekretär mit seinem Plädoyer offensichtlich auch den Arzt erreicht hat, der sich mit seiner Aussage fügt und nicht für den fiktiven Polizeipräsidenten einsteht.
Was die angesprochenen Protestlieder anbetrifft: Jede Bewegung hat ihre Lieder. Und so hat auch die erfundene Gruppierung, zu der sich die fiktive Attentäterin in diesem „Tatort“ bekennt, ihr fiktives Liedgut, an dem sie sich aufrichtet. Die beiden Lieder, die im Film vorkommen, stammen jedoch nicht aus einem anderen Kontext, sondern sind extra für den „Tatort“ gedichtet und komponiert worden, ohne irgendeinen Bezug zu bestehenden Liedern oder Liedermachern.
Sie geben die Haltung der fiktiven Charaktere wieder, welche sie singen bzw. mögen und sind daher in einem ausschließlich fiktiven Sinne ideologisch geprägt. Damit wird also keine andere Bewegung oder ihre Lieder diskreditiert.
Im Ergebnis kann ich nicht erkennen, dass die angesprochenen „Tatort“-Folge Programmgrundsätze verletzt haben soll. Vielmehr handelt es sich um ein Werk, das eine fiktive Geschichte erzählt und für das die Garantien der Rundfunk- und Kunstfreiheit stehen. Der „Tatort: Verblendung“ hat mit seiner differenzierten erzählten erfundenen Handlung niemanden bewusst verletzt oder diskreditiert.
Gemäß § 20 Abs. 3 der SWR-Hauptsatzung steht es Ihnen frei, den zuständigen Ausschuss anzurufen und die Beratung der Beschwerde zu verlangen. Der zuständige Ausschuss im vorliegenden Fall ist der Programmausschuss Information.
–
Was haltet ihr von der Antwort?
Wir empfehlen auf jeden Fall, wenn ihr zu den Beschwerdeführern gehört, eine Eskalation der Beschwerde (geht einfach über die App).
Beste Grüße,
Euer Rundfunk-Alarm-Team

