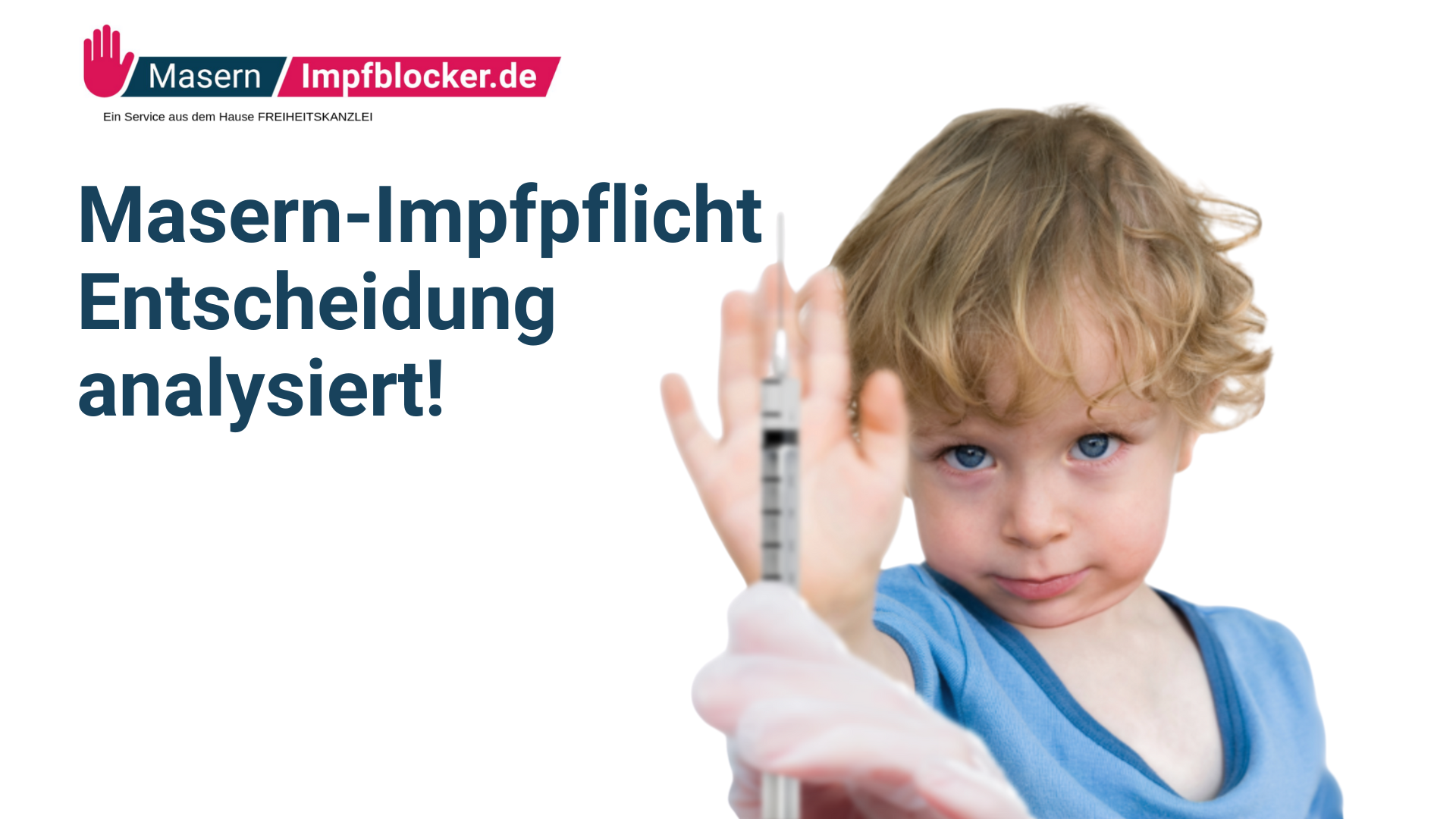Das Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hat am 21.07.22 zur Masern-Impfpflicht eine Entscheidung getroffen. Hier fassen wir die Analyse zum Thema von Frau Dr. Johanna Weber zusammen. Den vollständigen Text der Analyse findet man HIER.
Zusammenfassung der Analyse von Dr. Johanna Weber vom 01.07.2023
Verfassungsrechtliche und epidemiologische Bewertung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Masern-Impfpflicht
1. Einleitung
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Masern-Impfpflicht hat weitreichende Implikationen für den Schutz individueller Grundrechte sowie für die epidemiologische Bewertung der Notwendigkeit einer solchen Maßnahme. Eine detaillierte Analyse zeigt erhebliche methodische Mängel in der Argumentation des Gerichts, insbesondere in Bezug auf die Verwendung veralteter Daten und eine unzureichende Risiko-Nutzen-Abwägung. Darüber hinaus ist die Rolle der Ständigen Impfkommission (STIKO) kritisch zu hinterfragen, insbesondere hinsichtlich ihrer finanziellen und institutionellen Abhängigkeiten, die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit aufwerfen. Der folgende Beitrag untersucht die rechtlichen und wissenschaftlichen Aspekte dieser Entscheidung umfassend.
2. Methodische und epidemiologische Defizite
2.1 Veraltete Datenlage und unzureichende wissenschaftliche Grundlage
Das Urteil des BVerfG stützt sich weitgehend auf epidemiologische Daten aus dem Jahr 2018 und früher, ohne aktuelle Erhebungen des Robert Koch-Instituts (RKI) aus den Jahren 2020 bis 2022 angemessen zu berücksichtigen. Dabei zeigen die neuesten verfügbaren Daten des RKI einen deutlichen Rückgang der Masernfälle:
- 2020: 76 gemeldete Fälle
- 2021: 10 gemeldete Fälle
- 2022: 13 gemeldete Fälle
Diese Zahlen deuten darauf hin, dass das Masernvirus in Deutschland möglicherweise bereits als eliminiert gelten könnte, was eine Impfpflicht epidemiologisch infrage stellt.
Besonders problematisch ist die Tatsache, dass das Gericht keine differenzierte Analyse der Altersgruppen vornimmt. Während die Impfpflicht vorrangig für Kinder in Kindertagesstätten gilt, fehlen aktuelle Daten zur Maserninzidenz in dieser spezifischen Altersgruppe. Es ist zudem unklar, wie viele der gemeldeten Masernfälle tatsächlich aus ungeimpften Kindern in Betreuungseinrichtungen resultieren. Ein evidenzbasiertes Urteil hätte hier eine umfassende Datenanalyse vorausgesetzt, die vom BVerfG jedoch nicht durchgeführt wurde.
2.2 Fehlende absolute Risiko-Nutzen-Abwägung
Ein weiterer schwerwiegender methodischer Fehler liegt in der ausschließlichen Betrachtung der relativen Risikoreduktion durch die Impfung. Das BVerfG zieht nur die Wirksamkeit der Impfung im Sinne einer Reduktion der Masernfälle heran, ohne jedoch die absolute Wahrscheinlichkeit einer Infektion und eines schweren Verlaufs für die Zielgruppe zu analysieren.
Die absolute Risikoreduktion berücksichtigt, wie wahrscheinlich eine Infektion in der Gesamtbevölkerung ist und ob das Risiko schwerer Erkrankungen das Risiko möglicher Nebenwirkungen der Impfung überwiegt. Eine umfassende Analyse zeigt jedoch, dass diese Annahmen nicht haltbar sind:
- Die Gesamtinzidenz von Masern ist in Deutschland sehr gering.
- Der Nutzen der Impfung für die Mehrheit der geimpften Kinder ist daher minimal.
- Die Wahrscheinlichkeit schwerer Nebenwirkungen durch die Impfung ist statistisch relevanter als das Risiko eines schweren Masernverlaufs.
Eine Analyse des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) dokumentiert über elf Jahre 1.301 schwere Impfnebenwirkungen, was das Risiko für Impfschäden relativ zur Masernerkrankung als erheblich erscheinen lässt. Insbesondere schwere Komplikationen wie Enzephalitis, Autoimmunerkrankungen oder neurologische Störungen sind zu berücksichtigen.
2.3 Interessenkonflikte und fehlende Transparenz bei der STIKO
Die STIKO wird im Urteil als „weltanschaulich neutral“ bezeichnet, doch eine genauere Untersuchung ihrer institutionellen Verflechtungen zeigt deutliche Interessenkonflikte.
2.3.1 Finanzierung und Einfluss durch die Pharmaindustrie
Die STIKO ist organisatorisch dem Robert Koch-Institut (RKI) zugeordnet, das wiederum eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kooperiert. Die WHO erhält erhebliche finanzielle Mittel von privaten Organisationen, darunter:
- Bill & Melinda Gates Foundation: Die Stiftung ist eine der größten Geldgeberinnen der WHO und gleichzeitig stark in Impfstoffinitiativen wie GAVI involviert.
- GAVI-Impfallianz: Diese Allianz wird unter anderem von der Pharmaindustrie finanziert und setzt sich für weltweite Impfprogramme ein.
Da die WHO die wissenschaftliche Grundlage für viele nationale Impfempfehlungen bildet, besteht ein indirekter Einfluss der pharmazeutischen Industrie auf die deutschen Impfstrategien. Diese finanzielle Verflechtung kann dazu führen, dass wirtschaftliche Interessen in die Entscheidungsfindung einfließen, anstatt ausschließlich unabhängige wissenschaftliche Kriterien zur Anwendung zu bringen.
2.3.2 Intransparente Entscheidungsprozesse innerhalb der STIKO
Neben der fragwürdigen Finanzierung ist auch die Intransparenz der Entscheidungsprozesse innerhalb der STIKO ein gravierendes Problem. Zwar werden die Namen der Mitglieder veröffentlicht, jedoch sind die internen Beratungen, die Methodik zur Entscheidungsfindung und mögliche externe Einflussnahmen nicht öffentlich einsehbar.
Ein weiteres Problem besteht in der fehlenden Offenlegung individueller Interessenkonflikte der STIKO-Mitglieder. Es gibt keine strengen Vorschriften, die sicherstellen, dass Mitglieder potenzielle Verbindungen zur Pharmaindustrie offenlegen. In anderen wissenschaftlichen Gremien sind solche Transparenzanforderungen Standard, um mögliche Befangenheiten zu vermeiden.
3. Weiterführende verfassungsrechtliche Implikationen
3.1 Grundrechtseingriffe und Verhältnismäßigkeitsprüfung
Ein zentraler Punkt der rechtlichen Auseinandersetzung ist die Frage, ob die Impfpflicht einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte darstellt. Dies betrifft insbesondere:
- Das Elternrecht nach Art. 6 GG
- Die körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 GG
- Die allgemeine Handlungsfreiheit
Hierzu ist eine detaillierte Prüfung der Verhältnismäßigkeit erforderlich, die sowohl die Notwendigkeit als auch die Geeignetheit der Maßnahme umfasst.
3.2 Bedeutung für die Gesundheitsversorgung
Zwangsmaßnahmen im Gesundheitswesen haben häufig kontraproduktive Effekte. Eine Impfpflicht kann das Vertrauen in das Gesundheitssystem untergraben und langfristig zu einer höheren Skepsis gegenüber weiteren medizinischen Maßnahmen führen.
3.3 Langfristige gesellschaftliche Folgen
Die gesellschaftlichen Auswirkungen einer solchen Pflichtmaßnahme müssen ebenfalls betrachtet werden. Durch die Sanktionierung ungeimpfter Kinder wird eine Spaltung in der Gesellschaft gefördert, was langfristig zu verstärkten sozialen Konflikten führen kann.
4. Fazit und Ausblick
Die Entscheidung des BVerfG zur Masern-Impfpflicht ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch aus wissenschaftlicher Perspektive bestehen erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme. Es bleibt abzuwarten, ob künftige rechtliche Überprüfungen oder wissenschaftliche Neubewertungen zu einer Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen führen. Die Diskussion über die Impfpflicht muss auf einer umfassenden und evidenzbasierten Grundlage geführt werden, um tragfähige und legitime Entscheidungen zu ermöglichen.
–
Vollständige Analyse von Dr. Johanna Weber zu (Urteil des BVerfG vom 21.07.2022–1 BvR 469/20) vom 01.07.2023 – hier herunterladen.
Zusammenfassung von Songül Schlürscheid (Telegram / X)